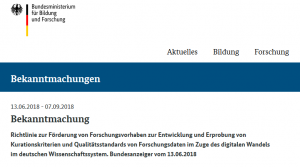Die am DIW Berlin angesiedelte forschungsbasierte Infrastruktureinrichtung Sozio-oekonomisches Panel (SOEP) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n
SoftwareentwicklerIn (w/m/div) – (39 h/Woche)
Aufgaben
- Softwareentwicklung (Konzeption, Entwicklung, Pflege) im Bereich des Metadatenmanagements, insbesondere des webbasierten Metadateninformationssystems paneldata.org
- Entwicklung von Test-Suites für den Import von Metadaten
- Pflege von paneldata.org als Software im Produktivbetrieb
Anforderungen
- Abgeschlossenes Hochschulstudium (MA) der Informatik bzw. angrenzenden Fachgebieten und/oder Sozialwissenschaften
- Berufserfahrung im IT-Bereich, idealerweise in einem (sozial-)wissenschaftlichen Umfeld
- Fundierte Erfahrungen in der Programmierung in Python, insbesondere den Paketen Pandas und Django
- Erfahrungen in der Datenbankentwicklung mit SQL (PostgreSQL/SQLite), Elasticsearch und Redis
- Fundierte Erfahrung in der Arbeit mit Unix/Linux Systemen
- Idealerweise Kenntnisse und Erfahrungen in der Dokumentation sozialwissenschaftlicher Daten
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Wir bieten
Das Sozio-oekonomische Panel (SOEP) ist eine wissenschaftsgetragene repräsentative Wiederholungsbefragung, die bereits seit über drei Jahrzehnten läuft. Im Auftrag des DIW Berlin werden zurzeit jedes Jahr in Deutschland etwa 30.000 Befragte in fast 11.000 Haushalten befragt. Die Daten geben unter anderem Auskunft zu Fragen über Einkommen, Erwerbstätigkeit, Bildung oder Gesundheit und werden weltweit von WissenschaftlerInnen für ihre Forschung genutzt.
paneldata.org ist das zentrale Informationssystem für unsere internationalen NutzerInnen. Es dokumentiert die komplexen Daten des SOEP, als auch von anderen sozialwissenschaftlichen Panelstudien und soll die Arbeit der Forscher mit den Mikrodaten erleichtern.
(mehr)